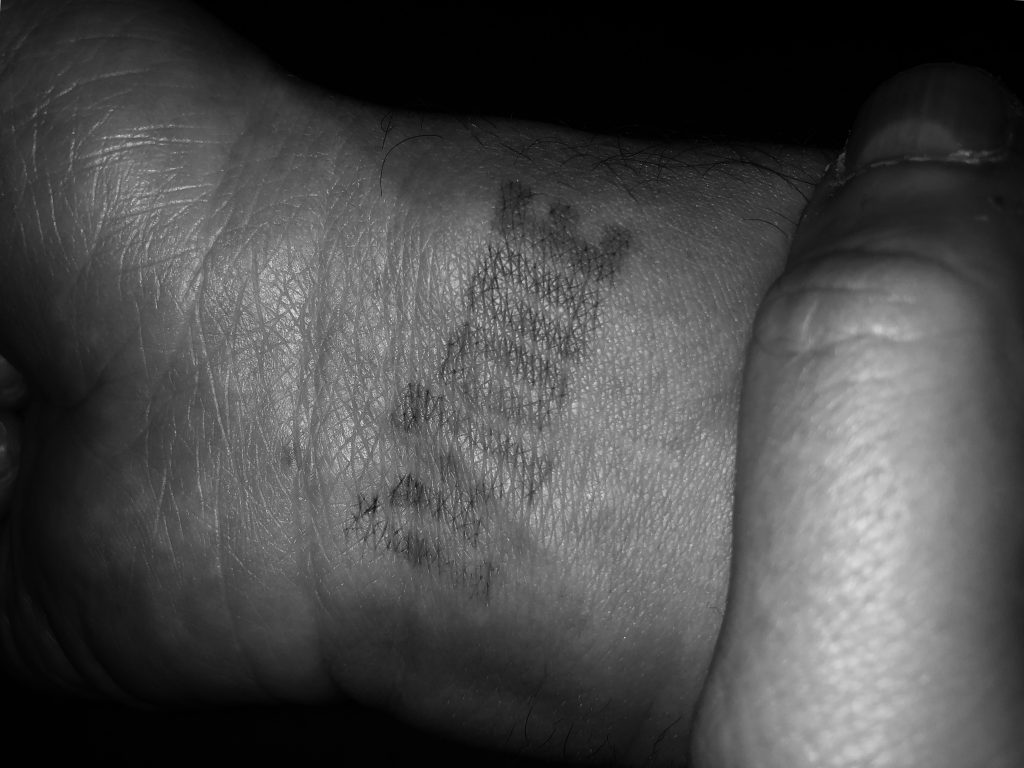©by M. Kuliniec
Der Stillstand. Nichts bewegt sich. Hinter dem Fenster sieht man nichts. Kein Fahrzeug. Nur ab und an der Polizeiwagen, der kontrolliert, wie viele Menschen auf der Straße sind. Und ob sich alle an die staatlichen Anordnungen halten. Und ob sie dann auch nicht zu nah einander laufen. Sonst bewegt sich nichts. Nicht mal die Blätter an dem Baum hinter dem Fenster. Nicht mal eine, die den blauen Himmel bedeckt. Es gibt unzählige Möglichkeiten, den Stillstand zu beschreiben. Es gibt auch genauso viele Reaktionen darauf. Und es liegt nicht nur an der kognitiven Möglichkeit, den Stillstand wahrzunehmen. Oder an dem kulturellen Kontext. Es liegt auch an den eigenen Strategien eines jeden Menschen, diesen zu gestalten.
Es gab Angst. Angst ob der vielen Zeit, die jetzt jeder hat und nicht weiß, was er damit anfangen soll.
Wie verhielten sich die Menschen während des Stillstands? Haben sie es überhaupt als Stillstand wahr genommen. Im März habe ich angefangen, zufällig und ganz unterschiedlich Fragen zu stellen. Dann habe ich fest gestellt, dass dies keine wissenschaftliche Methode ist, um den Zustand zu erkennen, zumindest war sie anthropologisch nicht sauber. Und dennoch halte ich sie für interessant. Wissenschaftliche Methoden können auch Lücken enthalten. Diese beschreibt Levy – Strauss in seiner “Strukturellen Anthropologie”. Ich würde hier nicht näher darauf eingehen wollen. Jedenfalls waren die Reaktionen sehr unterschiedlich. Und sehr vielfältig. Und nicht strukturiert.

©By Max Dogin
Es gab die Angst. Angst ob der vielen Zeit, die jetzt jeder hat und nicht weiß, was damit anzufangen. Das Fenster, aus dem ein Beobachter nichts sieht außer der Leere. Des Stillstands. Der Verlangsamung. Es gab Beobachter. Menschen, die beobachteten. Ich habe aber auch Menschen gesprochen, die es als Chance gesehen haben. Sich selbst zu verbessern. Oder endlich Bücher zu lesen.
Es gab Menschen, die ihr Leben einfach weiter lebten. Menschen, für die Social Distancing etwas alltägliches ist.
Es gab Menschen, die Entdeckungen gemacht hab.n. Zum Beispiel, dass sie jetzt von jedem Ort der Welt studieren könnten. Wenn sie denn den Ort erreichen könnten. Oder auch Menschen, die sagten, daß sie das erste Mal seit Jahren wirklich mit der Familie haben sprechen können. Ohne den Druck, dass sie keine Zeit haben, dass sie gleich wieder los müssen. Es gab nichts, wo sie denn hin müssten. Es gab darunter auch Familien, die sich mit ihren Kindern haben beschäftigen müssen. Und Menschen, die sich in der Einsamkeit eingeschlossen fühlten. Wie in einem Gefängnis. Die andere Menschen brauchten. Die den Kontakt mit den anderen suchten. Es gab aber keine anderen. Denn im Stillstand steht alles.

©by Max Dogin
Es gab aber auch Menschen, die einfach ihr Leben weiter lebten. Für die Social Distancing ein tägliches Leben war. Und die keinen signifikanten Unterschied zu früher gesehen haben,. Und die ihre Angst vor (oder Abneigung gegen) sozialen Kontakten jetzt bestätigt sahen. Oder aber Menschen, die alles positiv sahen. Und auch diejenigen, die in der Einsamkeit auf interessante Gedanken kamen. Daß dies alles von der Natur geregelt sei. Oder von einer anderen Kraft, die sie aber selbst nicht haben beschreiben können. Doch jeder hat die Einsamkeit gespürt. Aber Einsamkeit alleine ist kein Stillstand. Es ist die Frage nach dem Begriff der Zeit.
Wenden wir eine andere Definition der Zeit, begreifen wir Zeit als einen Raum, ein Kaninchen oder einen Spiegel, werden wir den Stillstand begreifen können.
Ich möchte an der Stelle nicht zu weit ausholen. Doch der Zeitbegriff ist sehr wichtig. Die Wahrnehmung der Zeit können wir nur so begreifen, wenn wir einen Begriff der Zeit haben. Wenn wir die Zeit als einen Verlauf vom Punkt A zum Punkt B definieren, können wir diesen Verlauf als schnell oder langsam definieren. Dies ist die kantianische Definition der Zeit. Wenden wir eine andere Definition, eine in der die Zeit keine Linie, sondern eine Kugel, ein Raum, ein Kaninchen oder ein Spiegel ist, begreifen wir den Stillstand anders. Aber das nur am Rande.
Die Beschleunigung. Denn es gab eine. Und vielleicht ist das das interessanteste an der ganzen Sache. Denn die Beschleunigung hat zwei Gesichter. Das erste ist offensichtlich. Und jeder meiner Gesprächspartner hat es sofort gesagt. Die Beschleunigung bei der Nutzung der Technologie. Vor Allem bei der Nutzung des Internets. Ich möchte es an dieser Stelle nicht bewerten.
Die Beschleunigung kann auch politische Auswirkungen haben.
Doch alle lernten schnell, wie Werkzeuge funktionieren, um Inhalte übers Netz an sehr viele Menschen weiter zu geben. Das kann auch positive Auswirkungen haben. Nicht nur auf die teilnehmenden Menschen. Auch auf diejenigen, die den Content nun empfangen können. Ich möchte an der Stelle nicht alles aufzählen, was sich da verändert hat. Fakt ist, dass sehr viele nun mit neuen Situationen haben umgehen lernen müssen. Schnell. Denn es gab keine andere Möglichkeit. Keine andere Chance. Es gibt Typen von Menschen, die eine solche Situation benötigen um Neues auszuprobieren. Die nicht die ersten sind. Das ist im Tierreich nicht anders.
Die Beschleunigung. Das zweite Gesicht. Denn es gab das zweite, das leise Gesicht. Etwas, was nicht so offensichtlich ist. Es gibt Drohnen, die in Paris das Verhalten der Menschen kontrollieren. Es gibt Polizisten, die dem Abstand der spazierenden Menschen ganz genau messen. Es gibt auch, so scheint es zumindest, einige Lager, die dieses Neue beurteilen. Doch darüber möchte ich jetzt nicht schreiben. Es gibt ein ganz neues Gesicht dessen, worüber Derrida schrieb, dass der Staat Gewalt anwende um das Recht durchsetzen zu können.
Ein Spaziergang kann plötzlich staatliche Organe auf den Plan rufen. Ein Treffen mit Freunden wird als Gefahr für die Allgemeinheit angesehen.
Es ist keine neue Qualität dieser Gewalt. Es ist ein neues Recht. Es entstanden ganz neue Situationen, die aasgesellschaftliche Leben beeinflußt haben. Und es gibt immer noch ganz neue Überlegungen des Staates, wie das Recht angewendet wird. Und wie es ausgeweitet wird. Der Staat bekommt ein neues Gesicht. Und dieses Gesicht veränderte sich sehr schnell. Mit einer Geschwindigkeit, die wir nicht mal bemerkten. Oder doch. Wenn wir beim Treffen mit Freunden erfuhren, dass es plötzlich verboten ist. Wenn wir für alltägliches Verhalten plötzlich mit Strafen haben rechnen müssen. Wenn ein Spaziergang plötzlich staatliche Organe auf den Plan rief. Sicherlich. Der Staat kann es immer wieder legitimieren. Es ist aber hier nicht die Frage. Die Beschleunigung kam schon ganz früh. Als nämlich Zizek auf die Frage Agambens nach dem Sinn der Maßnahmen Partei bezog und sich hinter Hegel verbarrikadierte. Die Barrikaden scheinen bis heute Bestand zu haben. Die Linien ebenfalls. Und die Zeit spielt hierbei eine sehr wichtige Rolle.

©by Max Dogin
Verlorene Freiheiten werden nur selten ohne Weiteres zurück gegeben.
Die Änderung. Und sie bleibt auch dann so verändert. Darauf macht Hans – Georg Gadamer in seiner Lektüre Heraklits aufmerksam. Die Änderung in der Vision Heraklits ist etwas seltsames. Denn wir wissen, dass sie kommt. Daß etwas sich grundlegend ändern wird. Daß sie bald da ist. Wie ein Krieg. Wir hören schon die Kanonen. Oder lesen in einer Zeitung von einem Virus, das sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet. Und wir leben das alte Leben noch. Als wenn nichts passieren würde. Der Krieg ist ein Prozess. Auch die Ausbreitung einer Pandemie. Es geschieht nicht von heute auf morgen. Aber da wir in einer Zeitvorstellung gefangen sind, die nach dem A ein B verlangt und sich nicht überlegt, dass vielleicht bei A die Reise stehen bleibt, wissen wir, dass B kommt. Auch wenn wir bei A noch keine Vorstellung vom B haben. Dann kommt B.
Zweimal in den selben Strom können wir nicht einsteigen. Es gibt kein Zurück zu früher.
Und alles ändert sich plötzlich. Serge Halime schrieb in der Aprilausgabe der Le Monde Diplomatique, dass erlassene Gesetze sehr selten zurück genommen werden. Dass verlorene Freiheiten nur selten ohne weiteres zurück gegeben werden. Dass der Zustand B jetzt andauert. Und wir haben uns sehr schnell an diesen Zustand gewöhnt. Wie an die Masken. Die wir angehalten sind, überall in geschlossenen Räumen zu tragen.
Das andere Phänomen, das Heraklit beschreibt ist eben eine Beständigkeit. Oder ein Stillstand. Dass wir nämlich zu dem Alten nie wieder zurück kehren werden. Dass wir in der neuen Realität bleiben werden. Dass wir nicht zweimal in den selben Strom einsteigen können. Dass auch wenn wir in den Fluß steigen, wir nicht mehr in dasselbe Wasser steigen werden. Denn die Zeit fließt. Und das B ist nun auch A. Und das alte A wurde ausgelöscht. Für immer. Und ein C steht am Horizont. Und es sieht schlimmer aus als das B. Und es kommt. Wie die Kanonen.
Wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat, können Sie den Autor und den Fotografen gerne mit einer kleinen Spende unterstützen. Nutzen Sie dafür den folgenden Link:: paypal.me/mkuliniec und nennen den Titel des Beitrags. Danke!