Titanic: cała wstecz i jednocześnie do przodu
Titanic: cała wstecz i jednocześnie do przodu
Text ©by Marek Gajdziński
Photos ©by Mariusz Olszewski
We proudly present the third part of the essay by Marek Gajdziński. The third part will follow in some weeks. The first part you would find here.
We also proudly present photos made by Mariusz Olszewski.

5.
Na nowy film Franco czekaliśmy z niecierpliwością. I co teraz? Satysfakcja czy rozczarowanie? I jedno, i drugie. Dwa w jednym, a wszytko od punktu widzenia uzależnione. Jako opowieść o epizodzie z kończącego się życia pewnego człowieka – film taki sobie. Dobra opowieść, ale niczego nie urywa. Perspektywa spojrzenia na ten film jak na przypowieść o ekologicznym problemie i przyszłości naszej cywilizacji wydaje się dużo ciekawsza i obiecująca. Ale zacznijmy od tytułu.
Oryginalny tytuł, Sundown, to jedno słowo. U nas też jedno, zmierzch. Albo dwa: zachód słońca. Ale żeby opisać znaczenie innego słowa, driftwood, trzeba więcej niż dwa słowa. Choć słownik gógla tłumaczy driftwood jako drzazga – ale chyba nie ma racji. Bo to określenie na drewno, które albo dryfuje, jak deska albo kawałek gałęzi na powierzchni morza, albo na brzegu leży, wyrzucone przez fale. Albo w kominku się pali, jak już zostanie z plaży zabrane. Nie mamy zatem, jak użytkownicy języka angielskiego, jednego słowa na tę całą masę drewna. Podobna sytuacja występuje pewnie w wielu innych mowach. Możliwe, że dlatego właśnie producenci zdecydowali się zmienić tytuł filmu, z Driftwood na Sundown. Choć Tim Roth, odtwórca głównej roli uważa, że pierwotny tytuł bardziej pasował do tego, o czym film opowiada. Bo przyjął, że film jest przede wszystkim o nim. Czyli o facecie, który coś ważnego utracił, choć sam nie wie dokładnie co, i nie ma pojęcia, co dalej z sobą i ze swoim życiem zrobić. Więc dryfuje. I daje się falom wyrzucać, to tu, to tam. Leży na brzegu oceanu z wiaderkiem pełnym butelek z piwem pod ręką. Popija, przysypia, popija. I bez widocznego poruszenia przygląda się brutalnemu zderzeniu ogromnego bogactwa z równie niepojętą biedą. W Acapulco, mieście znanym z pięknego położenia i spektakularnych nierówności, przemocy, zorganizowanej zbrodni. Ale –

Ale jeśli zmienić punkt widzenia i nieco poszerzyć perspektywę, można uznać ten film za przypowieść nie tylko o tym, do jak żałosnych skutków prowadzi bezrefleksyjna pogoń za zyskiem, ale również o naszym cywilizacyjnym uzależnieniu od mięsa i o przemysłowym zarzynaniu zwierząt. Dlaczego? Tego wyjaśnić nie sposób, nie psując przyjemności z oglądania i rozszyfrowywania mniej lub bardziej oczywistych znaczeń fabuły wszystkim tym, którzy jeszcze filmu nie widzieli. Możemy tu wspomnieć jedynie, że odwiedzający meksykański kurort Neil Bennett, grany przez Rotha, jest spadkobiercą fortuny wypracowanej przez rodzinny biznes w Brytanii, sieć rzeźni i sklepów mięsnych. I jak tylko trzeźwieje, zaraz pojawiają mu się te rozkrojone ciała świń i kałuże krwi przed oczyma. Więc szybko sięga po butelkę. W każdym razie przypowieść ułożona (napisana i wyreżyserowana) przez Michela Franco ma też taki właśnie, ekologiczny przekaz, że albo zmierzch przemysłu mięsnego, albo zmierzch cywilizacji. Że tylko taki wybór mamy. Tak w skrócie.
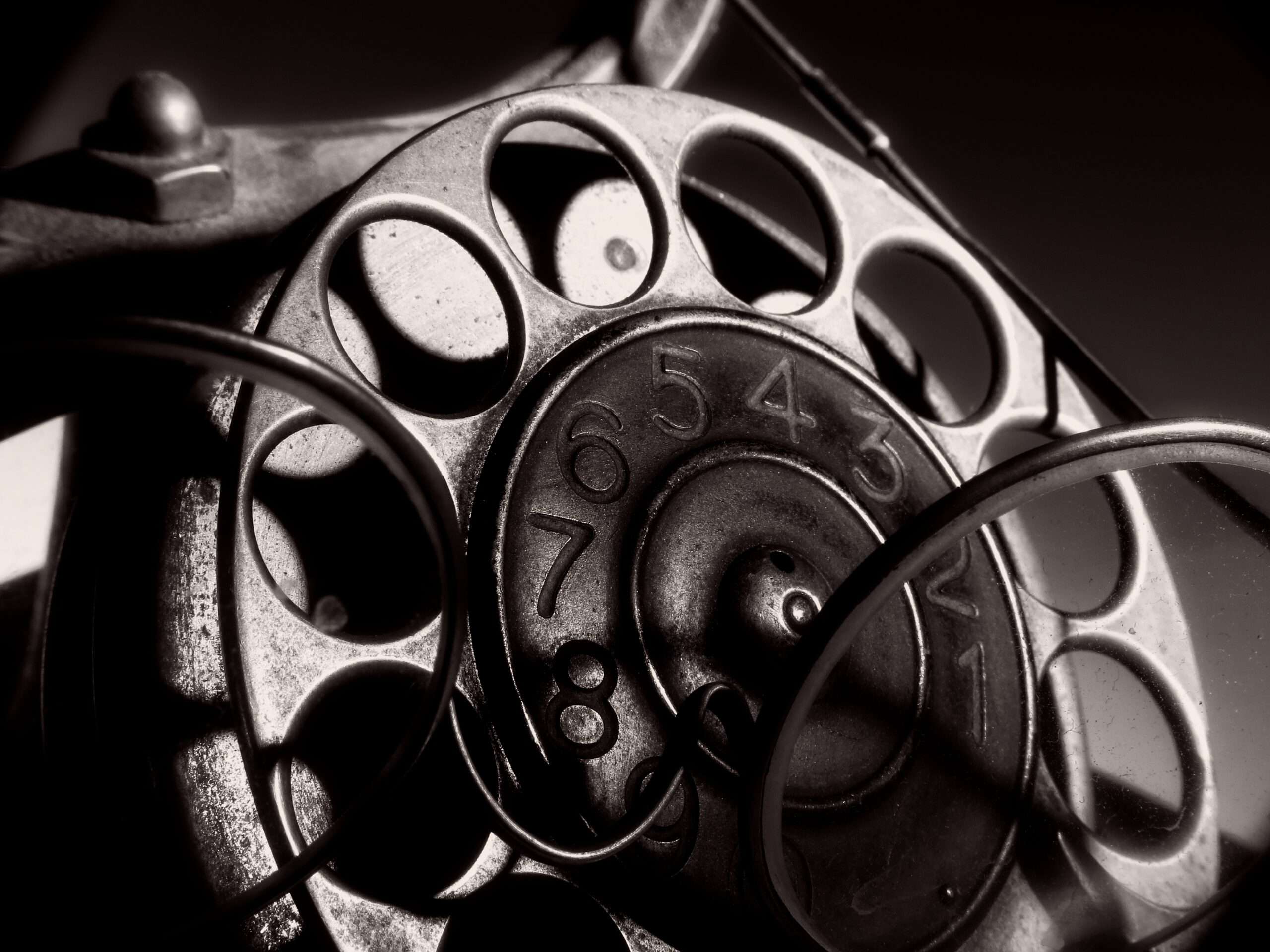
6.
Sformułowanie “cała wstecz i jednocześnie do przodu” miało wyrażać naszą bezradność wobec prostego, wydawałoby się, pytania: dokąd zmierzamy? Albo dokąd powinniśmy. Ale daje też nadzieję. Bo w czasach, kiedy nie znano jeszcze abeesów, kierowcy rajdowi tak sobie radzili, kiedy jechali po śliskiej nawierzchni. Na przykład po lodzie. Wciskali jedną nogą pedał gazu, drugą hamulec. By nie utracić przyczepności i zachować kontrolę nad kierunkiem posuwania się pojazdu. W sytuacji, w której się znaleźliśmy, przypominającej ostatnie chwile Titanica, zawołanie cała wstecz i jednocześnie naprzód może mieć ukryty sens. Podsuwać inny niż po prostu do przodu czy do tyłu kierunek. Niebinarną, trzecią drogę. Jak w tym kawałku z Cage’a, z tego samego tomu wykładów: “Jeśli ty i tatuś się rozstaniecie, nie zostanę ani z tobą, ani z nim. A co zrobisz, spytała mama. Wrócę do natury”.[1]

[1] “If you and Daddy
get a divorce, I’m not going to go
with you and I’m not going to go
with Daddy.” His mother said, “Where
would you go then?” “I’d go back to
nature.” (Johne Cage, “Diary: How to improve the World – you will only make matters worse – continued, 1967”, w tegoż A Year from Monday: New Lectures and Writings, Middletown, Connecticut: Wesleyan University Press, 1967, p. 158)
Marek Gajdziński jest pisarzem, dramaturgiem, tłumaczem literatury i nauczycielem. Powieści i opowiadania: Spacer do kresu dnia (Iskry, 1989), Głowa konia (Państwowy Instytut Wydawniczy, 1996), Droga do Indii (Zielona Sowa, 2000). Na podstawie opowiadań Tadeusza Różewicza i Marka Gajdzińskiego w Teatrze Telewizji powstał spektakl Badyle (2020) w reżyserii Andrzeja Barańskiego.
Mariusz Olszewski, ur. w 1961. Absolwent UAM w Poznaniu, obecnie mieszka w Łodzi. Przez lata związany z Galerią Wschodnia w Łodzi. Artysta, wystawy w Polsce, Europie i Nowym Jorku. Współpraca przy filmach dokumentalnych z tematyki sztuki. Twórczość obejmuje poezję konkretną, instalację i fotografię.
Autorski opis jednej z wystaw, zatytułowanej “przestrzeń (nie) obecna // space (not) present”:
uchwycić nieuchwytne
dostrzec niedostrzegalne
usłyszeć niesłyszalne
powiedzieć niewypowiedzialne
nieobecność, a jednocześnie obecność
przestrzeń niepostrzegana, ale odczuwana
widziana zanika powoli
moment, gwałtowny bodziec i znów widziana
kiedy widziana, postrzegana jako chaos,
nieuporządkowany jeszcze porządek zdarzeń doświadczanych i zapominanych
okazja na (ponowne) uporządkowanie albo nieodwracalne odesłanie w niepamięć
Titanic: cała wstecz i jednocześnie do przodu
Titanic: cała wstecz i jednocześnie do przodu
Text ©by Marek Gajdziński
Photos ©by Mariusz Olszewski
We proudly present the second part of the essay by Marek Gajdziński. The third part will follow in some weeks. The first part you would find here.
We also proudly present photos made by Mariusz Olszewski.

O poprzednich dwóch filmach Rubena Östlunda (Turysta (2014), The Square, 2017) mówi się, że ich naczelnym tematem jest absurdalność męskiego świata. I w tym sensie W trójkącie (Triangle of Sadness, 2022) zdecydowanie się w ów temat wpasowuje, zamykając, być może, tę trylogię. Natomiast w jakimś wywiadzie, z 2018 roku, reżyser powiedział, że jego filmy są przede wszystkim o ludziach, którzy mierzą się z niespodziewanym kryzysem i – zamiast skupić się na rozwiązywaniu problemu – próbują za wszelką cenę zachować twarz. Jak ten ojciec z Turysty (2014), który udaje, że nie uciekł i nie zostawił rodziny na pastwę lawiny. Z tego punktu widzenia, Trójkąt jest taki sam i zarazem inny. Taki sam, bo też się tu ludzie mierzą. Inny, bo nie tylko faceci, wszyscy tu jakby tracą twarz od razu i tak im już do końca zostaje. Nie bardzo też widać, żeby jakoś specjalnie starali się ją odzyskać. To znaczy nie wszyscy. Bo owszem, Yaya (w tej roli Charlbi Dean, RIP) i Carl (Harris Dickinson), dwójka bohaterów, jak najbardziej, traci na dobre, ale przynajmniej trzy postaci twarz (na swój sposób) zachowują. Bo od początku do końca są sobą: (1) Thomas Smith (Woody Harrelson), kapitan, alkoholik, marksista rzucający cytatami z pism Marksa i Chomskiego; (2) Dimitry (Zlatko Burić), zabawny, bogaty rusek (zbił miliardy na sprzedawaniu gówna, jak sam to określa), który po pijaku, chwilę przed katastrofą, ogłasza przez interkom, że jest nowym właścicielem statku; (3) i, przede wszystkim, Abigail (Dolly de Leon, świetna rola!), najpierw jako niczym nie zwracająca na siebie uwagi konserwatorka powierzchni toaletowych, na statku, później, na wyspie, nowa kapitanowa – czy raczej kapitanka? – w każdym razie szefowa wszystkiego tego, co pozostało po katastrofie w burdelu.

Trójkąt smutku (bo raczej tak powinien brzmieć ten tytuł po polsku) określa zmarszczenie skroni w trójkącie oczu i nosa, co nadaje człowiekowi smutny widok. Dowiadujemy się tego podczas sceny castingu dla modeli, w akcie pierwszym. Sformułowanie to na różne sposoby odnosi się do wszystkich trzech aktów, które składają się na narracyjny trójkąt. W akcie drugim najbardziej oczywiste skojarzenie to smutek cywilizacji opartej na nierównościach społecznych, pokazany w soczewce stosunków międzyludzkich na luksusowym krążowniku wycieczkowym. Załoga i bogaci goście, których pozycję ładnie podkreśla powtarzająca się fraza “in den Wolken” (w chmurach), jedyne słowa, które potrafi wypowiedzieć pewna Niemka (Iris Berben w roli Therese), częściowo sparaliżowana po wylewie (przypomina się tu człowiek cierpiący na zespół Tourette’a, który podczas wywiadu z artystą przerywa mu opowieść o tym, jak fascynuje go społeczny rezonans jego sztuki, krzycząc kilka razy “wybierdalaj” albo “ty lagociągu”, z poprzedniego filmu Östlunda, The Square, który też przyniósł mu Złotą Palmę). W akcie trzecim tytułowa figura geometryczna przywodzi na myśl Trójkąt Bermudzki, kiedy wycieczkowiec tonie, a garstka ocalonych trafia na tajemniczą wyspę, która z jednej strony jest bezludna, z drugiej zaś –
[treść usunięta na podstawie przepisów ustawy o zapobieganiu psujawkowaniu, praktyce znanej też jako spojlerowanie, z dnia –]
Natomiast w kontekście pytania o kierunek zmian, film wskazuje zarówno na powrót do utraconych wartości, jak i poszukiwanie wartości nowych jako odpowiedź na pytanie, jak (próbować) uniknąć nadchodzącej, trwającej już katastrofy. Albo chociaż zmniejszyć jej skalę. Ta pierwsza, utracona wartość, to matriarchat. Östlund podsuwa nam go pod rozwagę, pokazując społeczną wagę silnych kobiet, które potrafią czerpać mądrość ze świata przyrody. Choć nie bez mrugnięcia okiem – Abigail, kiedy dociera do niej, że bez niej, bez jej umiejętności polowania, grupa skazana jest na śmierć głodową, bierze sobie nie tylko stanowisko przywódczyni, ale też Carla jako osobistego maskota, przytulanka uprzyjemniającego zasypianie.

Zniesmaczenie Carla potęguje reakcja jego partnerki, Yayi (Charlbi Dean), która patrzy na drapiącego się po podbrzuszu brodacza w topless z wyraźnym zainteresowaniem.
Ale to kobiece spojrzenie filmowe dalekie jest od ostentacyjności. Można zaryzykować stwierdzenie, że Östlund szuka optyki, która nie byłaby ani specjalnie męska, ani kobieca. Czyje to spojrzenie? Jego? A może nasze? Nasze również w sensie takim, w jakim w stosunku do osób niebinarnych używamy liczby mnogiej.[1]

Część trzecia wkrótce…
[1] Choć z drugiej strony, spojrzenia takiego nie trzeba specjalnie szukać. Bo mimo że to prawda, że męskie spojrzenie wciąż w przemyśle filmowym dominuje, zwłaszcza w kinie rozrywkowym, prawdą jest również to, że mamy już cały osobny nurt filmów robionych z perspektywy kobiecej i “naszej”. Dużą ich porcję można było zobaczyć w ramach Post Pxrn Film Festival, najpierw w czerwcu tego roku, w kinie Muranów w Warszawie, później w Poznaniu, w Muzie, podczas Festiwalu Rozkosz.
Marek Gajdziński jest pisarzem, dramaturgiem, tłumaczem literatury i nauczycielem. Powieści i opowiadania: Spacer do kresu dnia (Iskry, 1989), Głowa konia (Państwowy Instytut Wydawniczy, 1996), Droga do Indii (Zielona Sowa, 2000). Na podstawie opowiadań Tadeusza Różewicza i Marka Gajdzińskiego w Teatrze Telewizji powstał spektakl Badyle (2020) w reżyserii Andrzeja Barańskiego.
Mariusz Olszewski, ur. w 1961. Absolwent UAM w Poznaniu, obecnie mieszka w Łodzi. Przez lata związany z Galerią Wschodnia w Łodzi. Artysta, wystawy w Polsce, Europie i Nowym Jorku. Współpraca przy filmach dokumentalnych z tematyki sztuki. Twórczość obejmuje poezję konkretną, instalację i fotografię.
Autorski opis jednej z wystaw, zatytułowanej “przestrzeń (nie) obecna // space (not) present”:
uchwycić nieuchwytne
dostrzec niedostrzegalne
usłyszeć niesłyszalne
powiedzieć niewypowiedzialne
nieobecność, a jednocześnie obecność
przestrzeń niepostrzegana, ale odczuwana
widziana zanika powoli
moment, gwałtowny bodziec i znów widziana
kiedy widziana, postrzegana jako chaos,
nieuporządkowany jeszcze porządek zdarzeń doświadczanych i zapominanych
okazja na (ponowne) uporządkowanie albo nieodwracalne odesłanie w niepamięć
Virtual metaphysics
Virtual Metaphysics

At the beginning a few definitions. And delimitations. As always with the articles here, it is food for thought to give someone new possibilities. Or new perspectives. Or simply about expanding the old ones.
It is not a philosophical essay. There is no time for that. And also the place.
The concept of virtuality is a very old one. And causes different connotations. But here it will be about technology. And about interacting with the new technology. And to inquire about what constitutes the human being around the technology. Or are we merely an appendage of technology? And should we remain so?
1. The technology
Let’s not kid ourselves. Virtual reality technology is still… not really mature yet. Compared to the attempts around artificial intelligence, we are talking about children’s shoes here. Especially since we don’t know in which scenarios we will be able to use it. Virtual reality, then.
Mark Zuckerberg’s attempts (Metaversum) are rather ridiculous. They remind us of an early version of Second Life, and nobody really remembers Second Life anymore. In the end, SL became a big hangout for porn enthusiasts. What an achievement of Western civilization!
Apple, on the other hand, presented us with augmented reality rather than a truly virtual one some time ago. But that is very interesting. Because we seem to be more likely to accept this reality. And the scenarios for using it can also help us. Maybe they can help us understand ourselves better. In any case, they tell us a story. Namely, that we feel much more in an augmented reality than in a virtual one. We see the familiar environment, and we recognize other people around us (even if we wear funny-looking glasses). And we can “do something with it”. In contrast to the Metaversum, where we are completely immersed in an artificially created world, we feel better in our, perhaps not so ideal, one.

But Apple Glasses also tell us another story about ourselves. They are simply in the form of glasses. There are two panels built in, and two monitors that scan the environment for us. A bit like driving assistants.
If we see a familiar reality through glasses, it is merely an image. The image that cameras record and show us on the monitors. So we believe we are in a “familiar environment.” But this environment is already digitally edited.
2. Phenomenology
Postphenomenology deals with the question of how digitalization, how new technologies change our perception, and our view of the world. Therefore, it would be too simple to merely ask the question of phenomenology here. Especially since phenomenological theories have drifted into science. But what is at stake here is, simply, something else. It is about, as noted at the beginning, thinking about how human beings change. And not merely his perception. If we stayed with perception, we would be asking ourselves questions that have already occupied epistemologists. Namely, questions about what access to the world we have when we have funny glasses in front of our eyes. Glasses that pretend a familiar environment to us.
Hence, the following questions. What does a reality do to us that is not ours? And what will this reality look like if it is not created by us but by an AI? And will we be able to find our way around it?

3. The virtuality
It is remarkable that we perceive a pair of glasses that scans the environment and shows us an image of reality as more virtual than the image that a drone pilot sees on the monitor (I am talking about the large long-range drones that have the ability to fly over the ocean and kill a person from a distance). Such a pilot, by not being directly involved in the war, but going home to his family after work, ends up inventing stress.
And that is the first problem. We have become accustomed to thinking of virtuality as something alien. As a whole new reality. But (as the metaverse shows) it is the imagination of people. Other people think about how people would interact with reality. In which environment they would feel comfortable? What viewing habits do they have? It’s kind of like interior design. Or with urban development. Some environments we find too… artificial, too… virtual. We don’t feel comfortable there. Others, however, we prefer.
It is similar to the current AI. It is the result of our thoughts. It collects our data from the Internet and processes it. The results then are the result of mankind’s thoughts.
For this reason the first thought. Virtual reality is not a foreign one. It is our reality. Concentrated on two monitors in a pair of glasses.
End of Part I
Titanic: cała wstecz i jednocześnie do przodu
Titanic: cała wstecz i jednocześnie do przodu
Text ©by Marek Gajdziński
Photos ©by Mariusz Olszewski
We proudly present the first part of the essay by Marek Gajdziński. The second part will follow in some weeks.
We also proudly present photos made by Mariusz Olszewski.

Cała wstecz! Znaczenie tego sformułowania, wyrażające współczesny lęk przed zmianami i tęsknotę za “starymi, dobrymi czasami”, zależy od kierunku, w którym się posuwa. Co? Cokolwiek. Choćby my wszyscy. Czy ludzkość jako całość posuwa się w jakimś konkretnym kierunku?
Zmierzamy ku zagładzie. I w niej ratunek. Paradoksalnie. Bo im większy strach przed globalnym kataklizmem, tym większa szansa, że ktoś wreszcie wpadnie na jakiś rewolucyjny pomysł. I da się to wszystko w ostatniej chwili wyprostować. Powie ktoś, kto mimo wszystko z ufnością patrzy przed siebie. Przyszłości, choć niezbadana, zawsze lepsza niż to, co już było.
Ale pewniej jeszcze możemy się od zagłady uchronić, robiąc mądry krok wstecz. A nawet kilka takich kroków. Ludzkość może wrócić tam, skąd wyszła. Porzucić pochopnie, błędnie poczynione wybory. Przestać pozwalać na pewne zjawiska. Postawić tamę. Albo mur. Powie ktoś, kto woli dawne, sprawdzone rozwiązania. Przeszłość jest lepsza niż przyszłość, bo wiadomo, czego się po niej spodziewać.
I rzeczywiście, obie te tendencje wydają się nami pospołu władać. We wszystkich możliwych dziedzinach życia. Choćby w podróży. Każda podróżna jest rozdarta między pragnieniem dotarcia do celu swojej podróży i powrotu do miejsca, z którego wyruszyła. Bez względu na to, czy i jak bardzo sobie owe pragnienia uświadamia. Dlatego też każda osoba musi, na jakimś etapie podróży, zadać sobie pytanie, skąd, dokąd i po co zmierza. Podobnie jest z nami wszystkimi. Pytamy, ale co z odpowiedzią? Wydawałoby się, że odpowiedzi powinna nam dostarczyć filozofia. Szczególnie jej dziedzina zwana metafizyką. Ale, jak już na tych łamach wykazano, kilka numerów temu, metafizyka jest dziedziną pełną wewnętrznych sprzeczności i tak paradoksalna, że nie wiadomo nawet, czy istnieje. Dlatego filozofowie, którzy nie wkraczają na pola wiary, nie są w stanie udzielić nam odpowiedzi na pytanie, w jakim kierunku się posuwamy. I czy to dobrze, czy źle. Zresztą zostawmy filozofię, kto dziś pamięta, kto rozumie, czym ona jest?

Podobny brak zgody co do podstawowych kierunków zmian widać w dziedzinie ekonomii. Jedni mówią, że trzeba nam coraz większego wzrostu gospodarczego. Drudzy wskazują, że to droga donikąd. Większość ludzi nie wie, co z tym zrobić. Więc na wszelki wypadek się bogacą. Pytanie, co to znaczy? Czy wzbogaconym ludziom rzeczywiście żyje się lepiej? Czy tylko więcej konsumują, męcząc tym siebie i całą resztę? Planetę. A może i wszechświat. Zjadają przy tym własny ogon – konsumują, by zagłuszyć strach przed konsekwencjami konsumowania. Cage napisał kiedyś, że “gdyby Amerykanie urodzili się byli świniami zamiast ludźmi, niczego by to nie zmieniło”. Chodziło mu o to, że Amerykanie stanowią tylko 6 procent ogólnej liczby ludzi na świecie, konsumują zaś dziesięć razy ponad normę, czyli aż 60 procent globalnych zasobów.[1] Napisał to w latach 1960, od tego czasu trochę się zmieniło. Ale nie w sensie takim, że Amerykanie mniej konsumują. Zmiana polega na tym, że do Amerykanów dołączyły kolejne, ustawione w ogonek grupy spragnionych dobrobytu. Najpierw zachodni Europejczycy. Teraz idą inni. To znaczy nie tyle idą, co kupują. Zużywają. Żrą.

Niedawno na pytanie, czy Polacy jedzą coraz więcej mięsa, jakiś ekspert od trendów żywieniowych odpowiedział, że nie, Polacy już od dawna nie jedzą mięsa – oni je żrą. Choć oczywiście nie tyle, co Amerykanie. Bo ci nadal wiodą prym. Cała ludzkość konsumuje w ciągu roku około 350 milionów ton mięsa zwierzęcego. To cztery razy więcej niż w latach 1960. Analiza danych statystycznych wskazuje, że gdyby każdy człowiek potrzebował do życia tyle mięsa, ile zjada przeciętny Amerykanin (czyli 124 kilogramy rocznie), nasza planeta mogłaby wyżywić jedynie dwa i pół miliarda ludzi. A jest nas, wiadomo. A to dlatego, że produkcja mięsa jest nieefektywna, zużywa nieporównywalnie więcej zasobów naturalnych niż produkcja żywności roślinnej. Żeby wyprodukować 1 kilogram warzyw, trzeba zużyć średnio 300 litrów wody. A żeby wyprodukować 1 kilogram wołowiny, 15 i pół tysiąca litrów wody. Czyli ponad 50 razy więcej. Z pola o powierzchni jednego hektara, obsadzonego ziemniakami albo ryżem, mogą się wyżywić rocznie 22 osoby. Gdyby na tym samym hektarze hodować krowy, wyżywiłaby się jedna, w najlepszy razie dwie osoby. (Nad)produkcja mięsa przyczynia się zatem do katastrofy klimatycznej (stanowiąc aż dwie trzecie globalnej emisji ekwiwalentu dwutlenku węgla) i do klęski głodu na świecie – według analityków ONZ, liczba głodujących ludzi wynosi 854 miliony, a 25 tysięcy umiera każdego dnia z powodu głodu.
Wróćmy do pytania, dokąd zmierza ludzkość? Czy posuwa się w jakimś konkretnym kierunku? Jak widać, zdania w tej kwestii są podzielone. Zależą od tego, kto skąd, jak i po co patrzy. I co chce zobaczyć. Wygląda na to, że zamiast wspólnego posuwania się dokądkolwiek, tkwimy w dramatycznym rozdarciu. Rozdarcie owo może odnosić się do całości, ale też do węższych obszarów. Takich jak wybór między autokracją a demokracją. Bandytyzmem a pokojowym modelem współżycia. Starym a nowym porządkiem. Jesteśmy jakby w rozkroku między tymi kierunkami. Niemożność dokonania zgodnego wyboru rodzi napięcie. Napięcie, nierozładowane, powoduje frustrację i pozbawione sensu, ekologicznie katastrofalne konflikty.
Co z tym wszystkim zrobić? Może pójść do kina? To pewnie samo w sobie niewiele zmieni, ale może być krokiem w dobrym kierunku. Pod warunkiem, że pójdziemy do odpowiedniego kina. Na dobry, wartościowy film – a nie tylko po to, by się na chwilę schować w ciemności i poprawić sobie humor. Choćby jeden z tych siedmiu prezentowanych w ramach Konfrontacji Filmowych 2022, w 24 kinach studyjnych w różnych miastach Polski. Pewnie każdy z nich dałby się przyporządkować do któregoś z rodzajów napięcia, aspektów naszego cywilizacyjnego rozdarcia. Wybierzemy tu dwa tylko filmy, bo na więcej nie mamy miejsca. Dlaczego akurat te dwa? Bo lepsze od innych? Niekoniecznie. Chodzi o to, że dwa modele wyborów w nich akurat zaprezentowane ściśle się ze sobą łączą. Jeden podsuwa nam komentarz dotyczący wyboru między porządkiem patriarchalnym a matriarchalnym, drugi odnosi się do wyboru – jeść czy nie jeść mięsa. A jak wykazała Carol Adams, autorka książki Seksualna polityka mięsa (Seksualna albo raczej płciowa – The Sexual Politics of Meat: A Feminist-Vegetarian Critical Theory, 1990), jedzenie mięsa jest ideologicznie uwarunkowane, stanowi zarazem źródło i owoc opresji nie tylko ludzi wobec zwierząt, ale też męskiej części ludzkości wobec żeńskiej.

Część druga wkrótce…
[1] U.S. citizens are six per cent
of world’s population consuming sixty
per cent of world’s resources. Had
Americans been born pigs rather than men,
it would not have been different. (Johne Cage, “Diary: How to improve the World – you will only make matters worse – continued, 1967”, w tegoż A Year from Monday: New Lectures and Writings, Middletown, Connecticut: Wesleyan University Press, 1967, p. 145)
Marek Gajdziński jest pisarzem, dramaturgiem, tłumaczem literatury i nauczycielem. Powieści i opowiadania: Spacer do kresu dnia (Iskry, 1989), Głowa konia (Państwowy Instytut Wydawniczy, 1996), Droga do Indii (Zielona Sowa, 2000). Na podstawie opowiadań Tadeusza Różewicza i Marka Gajdzińskiego w Teatrze Telewizji powstał spektakl Badyle (2020) w reżyserii Andrzeja Barańskiego.
Mariusz Olszewski, ur. w 1961. Absolwent UAM w Poznaniu, obecnie mieszka w Łodzi. Przez lata związany z Galerią Wschodnia w Łodzi. Artysta, wystawy w Polsce, Europie i Nowym Jorku. Współpraca przy filmach dokumentalnych z tematyki sztuki. Twórczość obejmuje poezję konkretną, instalację i fotografię.
Autorski opis jednej z wystaw, zatytułowanej “przestrzeń (nie) obecna // space (not) present”:
uchwycić nieuchwytne
dostrzec niedostrzegalne
usłyszeć niesłyszalne
powiedzieć niewypowiedzialne
nieobecność, a jednocześnie obecność
przestrzeń niepostrzegana, ale odczuwana
widziana zanika powoli
moment, gwałtowny bodziec i znów widziana
kiedy widziana, postrzegana jako chaos,
nieuporządkowany jeszcze porządek zdarzeń doświadczanych i zapominanych
okazja na (ponowne) uporządkowanie albo nieodwracalne odesłanie w niepamięć
Über Geister. Und Philosophie.
Postmoderne und Metaphysik

Es soll hier kein philosophischer Diskurs sein. Noch soll es einen Beitrag zu einem wie auch immer gearteten Diskurs werden. Es sind schlicht einige Gedanken, die mich seit einigen Monaten, vielleicht auch Jahren, begleiten. Vielleicht soll es auch eine Anregung sein. Und eine andere Perspektive.
Es ist auch vielleicht kein neuer Gedanke. Doch diese Idee reklamiert für sich gar nicht, neu zu sein. Sie ist einfach da. Erwähnenswert. Und kehrt ab und an zurück. Wie ein Geist.
1.Der Begriff der Postmoderne
Leider hat der Begriff der Postmoderne seit einigen Jahren (zumindest in der öffentlichen Debatte) eine negative Konnotation erhalten. Es hat sich von seiner ursprünglichen, philosophischen Bedeutung entfernt. Manche würden daher den Begriff des Poststrukturalismus vorziehen. Allerdings überschneiden sich die Bedeutungen beider Begriffe. Es überschneiden sich auch die Techniken, die der Poststrukturalismus und der Postmodernismus anwandten. Also ganz kurz. Es geht hier um den Begriff, den Denker, wie Lyotard, Derrida, Deleuze im Sinn hatten.
In Deutschland war einerseits durch eine starke Bindung an den Strukturalismus (Modernismus) mit seinen Ausprägungen der Frankfurter Schule und die Person Habermas aber auf der anderen Seite schlicht durch Eifersucht der hier agierenden Intellektuellen immer eher suspekt. Darauf möchte ich aber keine Rücksicht nehmen.

2. Die Dekonstruktion
Und es geht mir eher um die Kritik an ihr. Aber auch darum, dass die Postmodernisten modernistische (Strukturalistische) Begriffe dekonstruierten, in der Hoffnung, etwas Neues entstünde anstatt. Es kommt nicht immer wie man denkt. Doch das ist nicht das Thema. Die strukturalistische (modernistische) Welt war fein säuberlich aufgeteilt (vielleicht deswegen die große Liebe der Deutschen zum Modernismus). Auf der einen Seite hatten wir die physikalische Welt (deren Beschreibung schon zum Anfang des 20. Jahrhunderts nicht mehr so säuberlich war, was an der Quantenphysik lag) und auf der anderen Seite die Metaphysik. Das, was als „geistig“ galt und was Kant säuberlich in Kategorien aufgeteilt war. Wie wunderbar. Wie ordentlich!
3. Die Metaphysik
Es gibt eine landläufige Meinung, die besagt, die Postmoderne habe die Metaphysik zerstört. Es stimmt. Während Feyerabend die wissenschaftliche Methode kritisierte und diese auch dekosntruierbar gewesen wäre, so können Philosophen kaum die schwarzen Löcher zerstören. Die Frage, die sich mir stellt ist, war es tatsächlich die Metaphysik, die mit dem Postmodernismus zerstört wurde? Oder anders gefragt. Wurden die Werte (es ist die heutige Kritik an der Postmoderne) tatsächlich zerstört? Oder nur das, was wir als Beschreibung der Werte verstehen würden? Die schöne, kantianische (aber auch hegelsche) Ordnung der Dinge?

4. Die Geister
Und es geht hier gar nicht um eine „neue Metaphysik“. Machen wir uns keine Hoffnung. Wie es war, kommt nicht mehr. Wir können zwar versuchen, die alte Beschreibung wieder zu etablieren (und mancherorts passiert es) aber es hat keinen Sinn. Die Geister. Es ist eine Metaphysik. Vielleicht hat sie nichts mit Aristoteles zu tun. Vielleicht mehr mit Latour. Oder damit, was Christen „Glauben“ nennen? Oder einfach damit, dass Menschen, ein geistiges Leben haben.
Und das ist ein Punkt.
Es gibt noch einen anderen, den ich für wichtiger erachte. Und an Latour denken muss. In der modernistischen Beschreibung (ich weiß, das ist platt, aber eine Ausarbeitung würde zu lange dauern und zu viel Platz einnehmen) haben wir mit einer „fortschrittlichen“ Metaphysik zu tun. Mit einer Metaphysik, die sich an der kantianischen Theologie orientierte. Der Geist konnte nur ein heiliger sein. Oder seinen Platz in Testamentarischen Schriften haben. Daher auch der Glaube, dass der Glaube der Europäer etwas besonderes war. Vielleicht auch etwas fortschrittliches (wie auch immer die Modernisten unter uns den Fortschritt definieren).
5. Der weitere Punkt
Was ist also mit den Geistern? Nichts. Wir können sie suchen. Oder sie kommen nachts zu uns. Oder es ging um das Magische, das Wittgenstein beschrieb. Und manchmal ist es vielleicht sinnvoll in diese nichteuropäische Metaphysik einzutauchen. Und sie zu leben. Und die dortigen Geister besuchen.

JeanneDeClisson
Jeanne de Clisson
Text & artwork by Natasza Rogozinska

Natasza Rogozinska is a trained fashion designer, but she rather focuses on illustration and graphic design. Her works have been showcased in Vogue Poland, i-D Magazine, Kaltblut Magazine, Waste Not exhibition at the IFS Somerset House, London, and others. Natasza is now working on a master project, reviving stories about forgotten women from general history, myths, and legends. She combines traditional and analog techniques such as embroidery and linocut with digital art – to create a feminine chronicle of these forgotten stories.
We have already published one of her articles here. Today we proudly present her text and graphics.
If you would like to read more of her stories and watch more of her work, you can find them (external link) here.
When you hear about a brave French woman named Jeanne, first character that comes to mind is obviously Jeanne d’Arc. However, she was not the only battle-hardened Jeanne to tread the French lands. In the year 1300 Jeanne de Belleville – who, a mere 40 years later, would abandon noble manor and luxury – ws born into a wealthy family. Why did she forsake the aristocratic path, you may ask? The answer can be encapsulated in just one word: revenge.
Jeanne de Belleville was born as the daughter of French aristocrats, wealthy and highly respected. Her father, however, dies quickly – and Jeanne inherits the dominion over lands in Belleville and Montaigu as a result of this tragedy. As a 12-year-old (and this was apparently a suspicious age anyway, even for the Middle Ages) she enters into her first marriage with 19-year- old Geoffrey de Châteaubriant VIII, to whom she bears two children. In 1326, Geoffrey kicks the bucket and Jeanne prepares to marry Guy de Penthièvre – the marriage is, however, questioned by a certain (quarrelsome by nature) French family called the de Blois. Their exaggerated lament causes Pope John XXII to annul the scandalous marriage for political reasons, obviously. Guy then marries Marie de Blois – and dies shortly thereafter. Coincidence? Might be.
Meanwhile, Jeanne marries (without papal interference) Olivier IV de Clisson, a mighty Breton, who owned a castle in Clisson, an estate in Nantes and lands in Blain. Adding Jeanne’s lands to it suddenly it appears that the Clissons are becoming a true feudal power in Brittany. Olivier and Jeanne are well-respected and has a good reputation among Breton society. The de Clisson family quickly expands and now consists of not only Jeanne and Olivier, but also of their five children – Isabeau, Maurice, Olivier, Guillame and Jeanne. What the de Clisson family does not know yet is that they are on the eve of a succession war in Brittany – this will change their fate forever.
To understand the intricacies of this (one of many, as we all know) French-English argument, it should be mentioned that in the 14th century Brittany was a province ruled by a duke. The Bretons had a strong sense of Breton identity – even though their loyalties were divided between two kings – Philip VI of France and Edward III of England, the Bretons were always loyal to the duke above all. One can only imagine the cliffhanger that ensued when the Duke of Brittany, Jean III le Bon, dies childless in 1341. The war for the Breton succession is set in motion, with each side fielding its own player – in the blue corner you can see John de Montfort, backed by Edward III of England and in the red corner you can see Charles de Blois, sympathetic to Philip VI of France.

It was therefore necessary to take sides, to bet a few pennies on someone. Olivier de Clisson decides to support his childhood friend, Charles de Blois – who, after all, comes from the very same family of whistleblowers that denounced Jeanne and Guy de Penthièvre before the Pope. In 1343, Olivier and Hervé VII de Léon, as military commanders, defend the city of Vannes against attacks by the English – who eventually succeed after four attempts to force the city. Olivier and Hervé are taken into captivity, from which only Oliver emerges – exchanged for the English Ralph de Stafford and a suspiciously small sum of money. And that is when Charles de Blois stabs his childhood friend in the back – suggesting that Olivier surrendered Vannes to the English without a fight, what is more, since they exchanged him for such a small amount of money, he must have sold himself to the English. Treason!
In 1343, after the truce between England and France was officially signed, Olivier and fifteen other Breton and Norman noblemen are invited to a tournament to celebrate. However, there is no celebration foreseen for Olivier IV de Clisson – he is captured by his compatriots and taken to Paris – on charges of unthinkable treason. Jeanne, trying to save her husband, resorts to bribery – as a result of which the royal sergeant tries to delay Olivier’s trial. The truth comes out eventually and he gets arrested – as is Jeanne, who is not only accused of attempted bribery, but also of treason and disobedience. Finally, she runs away with the help of her eldest son, Olivier, as well as her squire and butler.
Meanwhile, on August 2nd, 1343, Olivier IV de Clisson finally stands trial – and is accused of conspiring and forming alliances with Edward III, an enemy of the French king and all of France. He is beheaded, and his head is taken to Nantes, where, impaled on a lance, it becomes a warning to others. This shocks the noblemen, because evidence of Olivier’s guilt is lacking, and moreover, desecrating the corpse and displaying it in public as a warning was the domain of the lowest class of slaughterers and criminals – not aristocrats.

Filled with fury and rage, Jeanne takes her two younger sons, Olivier and Guillame and heads to Nantes to show them their father’s head impaled on a lance and set on the city gates. She swears revenge to Charles de Blois and king Philip VI of France. She sells rest of the valuables, gather s400 loyal men and begins her crusade against France. She attacks the castle of Touffou, which was under the command of Galois de la Heuse, an officer of Charles de Blois. He allegedly recognized Jeanne and lets her in – after that her forces massacred the entire garrison, leaving only one wretch alive.
Soon after, with the help of the English king and Breton sympathizers, Jeanne organizes three warships, which are repainted black, their sails dyed blood red – and the flagship is christened with the name “My Vengeance.” Jeanne disguises herself as a pirate and goes to the sea with her Black Fleet. For the next 13 years, she hangs around the English Channel, spotting French merchant ships and attacking them without ruthlessness – always leaving one (un)lucky man alive to report to the French king that the Lioness of Brittany has caught up with them. And it was a tactic that can be described as guerrilla warfare at sea – disrupting the enemy’s logistics by attacking merchant ships, never military vessels.
In the end, however, the French manage to track down Jeanne and sink her flagship, so she drifts along with her sons for 5 days in troubled waters – as a result of this tragedy one of them, Guillame, dies. Jeanne and Olivier are eventually rescued by Jeanne’s allies, the de Montforts – and the Lioness of Brittany continues her pirate expeditions. In 1350, Jeanne marries for the last time – to Walter Bentley, closely related to King Edward III. They settled at Hennebont Castle and lived in relative peace for the next couple of years (not counting Walter’s little squabble with King Edward III over Jeanne’s estates). In December 1359 Walter dies, and a few weeks after him Jeanne – leaving behind a clear message: do not make baseless accusations of treason and do not desecrate the corpse – or the Black Fleet will catch up with you. Got it?

Notizen aus einer goldenen Zukunft
Notizen aus einer goldenen Zukunft

Heidegger (aber nicht nur er) kritisiert Hegels Begriff der Zeit. Er meint, aber es ist nicht nur Heidegger, wir lebten „jetzt“. Der Begriff der Zukunft leite sich vom Begriff der Gegenwart ab, in der das Seiende ist. Oder einfacher gesagt, wir erleben nur die Gegenwart, denn die Zukunft ist hinter dem Erfahrungshorizont versteckt. Wir werden sie nicht erleben (das ist nicht mehr Heidegger), denn unsere Vorstellung der Zukunft meistens von der Realität abweicht. Im Täglichen Leben scheint es kein Problem darzustellen. Doch wenn wir von größeren Projekten, gar von Gesellschaften sprechen, so kann diese Erkenntnis manch einen Revolutionär abschrecken (vielleicht deswegen sprechen Postanarchisten nicht mehr über das Konzept der Revolution).
Aber die Zeit?
Eben. Das Verständnis der Zeit. Wir werden sicherlich noch darauf zurück kommen. Die Frage wäre, was wir anstelle der Zukunft denn einsetzen, wenn wir diese noch nicht haben erleben können. Am Ende sollen wir einen Ort erreicht haben, der besser ist als der jetzige. Darauf gründet so manch ein Glaube an „die Entwicklung“ der Menschheit (wobei darunter meist die weiße Welt gedacht ist, die Zukunft der Pueblo Indianer oder der Massai wird ja schon von uns definiert). Habermas, der an die Zukunft der Moderne (was auch immer der darunter verstanden hat) glaubt, wird sicherlich dagegen sein. Als Marxist, stellt die Zukunft einen sehr wichtigen Aspekt. Baut der Marxismus doch auf Hegel und dessen Dialektik, die ein theologisches Projekt der Zukunft sein sollte.

Aber der Ort?
Auch er ist wichtig in unseren Überlegungen. Der Ort hat hier gleich zwei verschiedene Bedeutungen. Doch zu der foucaultschen komme ich auch gleich zurück. Zunächst der geografische. Und ich meine dabei nicht die Stadtentwicklungskonzepte, die in Heterotopien Orte der Zuflucht sehen. Diese können sofort geschaffen werden. Ohne Rückgriffe auf Revolutionen. Vielleicht ist das der Grund, weshalb solche Orte für Anarchisten sehr wichtig sind.
Nein. Hier geht es vielmehr um den geopolitischen Ort. Um Orte, die mit Techniken der Massenmedien, der kulturellen Verbreitung, der Sprache zu Utopien, zu Paradiesen werden (sollen). Um Orte, wie Europa (das weit verstandene Europa, das geografisch nicht gebunden ist). Um Orte, die eine Sehnsucht darstellen und sicherlich darstellen sollen.
Vielleicht ist es für diese Orte geopolitisch klug. Ein Sehnsuchtsort zu sein bedeutet gleichzeitig (das ist eine geopolitische Binsenweisheit), dass gleichzeitig die Kultur dieses Ortes als… ja… überlegen angesehen wird. Die Ideologie des Ortes (wir können es auch Gebiet nennen) wird in aller Welt verbreitet. Orte, die nicht im Zentrum sind, übernehmen die Ideologie. Übernehmen die Kultur. Werden auf diese Weise kolonialisiert. Und unsere Kolonien können sich vielleicht von uns lossagen. Sie können uns nie angreifen.

Gleichzeitig schotten sich diese Orte der Sehnsucht von der Welt ab. Erschweren das herkommen durch Visaregime und Mauern an Grenzen. Und exportieren ihren Diskurs, wodurch sie als führend in der Welt erscheinen (es betrifft nicht nur das geografische Europa oder die USA, viel mehr betrifft es Zentren der Imperien, wie Lyotard sie treffend beschrieben hat, unabhängig deren geografischer Lage).
Aber der Ort?
Die Sprache war von dem anderen Ort. Wenn ich es so nennen darf. Foucault ging es dabei aber eher um den Körper. Der eigene Körper, da er in Europa unsterblich geworden ist (nicht nur dadurch, dass wir den Tod aus der Kultur verbannt haben, wir haben auch die Definition, wann der Körper denn tot sei, verbannt), wird er zum Objekt des eigenen Kultes.
Es geht nicht um die Tatsache, dass durch Vergleiche auf Instagram oder Twitter einige Probleme mit dem eigenen Aussehen bekämen. Das wäre zu einfach. Und vielleicht ist die Darstellung auf Instagram und Twitter nur eine sehr extreme Komponente. In der Biopolitik hat der Körper eine sehr wichtige Rolle erhalten (wir sprechen jetzt auch nicht darüber, wo denn die Grenzen des Körpers seien, das wissen wir, Europäer, auch nicht wirklich und das, was wir als „Philosophie“ bezeichnen, kann auf diese Frage keine Auskunft geben). Der Körper soll nicht nur schön sein. Er soll auch möglichst gesund bleiben. Was auch immer wir unter dem Begriff „Gesundheit“ verstehen. Das interessante ist, dass es sich meistens um unsere Körper handelt, die wir betrachten. Die Körper der Flüchtlinge, tot oder lebendig, betrachten wir ja kaum.

Aber die Utopie?
Besser nicht. Es ist besser hier zu sein. Und jetzt. Vor allem jetzt.
Angst
Von der Angst
Wir müssen über Gefühle sprechen. Über Emotionen. Über die eine vielleicht. Wir sollten uns über Angst unterhalten. Denn Angst ist für einen Europäer eine sehr wichtige Erfahrung. Wir werden mit der Ontologie der Angst erzogen. Oder, um Heidegger zu paraphrasieren, die Welt in der wir als Seiende sind, ist voller Angst.

1. Heidegger und die Angst
Ich möchte an der Stelle Martin Heidegger nicht analysieren. Vermutlich wäre es zu kompliziert. Und es würde zu viel Platz nehmen. Und vielleicht habe ich ihn nicht verstanden. Außerdem sollen es wie immer lediglich einige Gedanken werden. Vielleicht eine Anregung. Vielleicht auch nicht.
Heidegger unterscheidet zwischen Angst und Furcht. Angst, meint er, spürten wir vor unbekanntem, vor etwas, das wir nicht kennen. Furcht hingegen würden wir spüren, wenn wir wissen, was kommt (die Heidegger Kenner mögen mir an der Stelle die Verkürzung verzeihen, es geht mir eher um das Vorkommen des Begriffes denn um die korrekte Wiedergabe).
Angst also. Da wir im Leben stets vor dem Erkenntnishorizont stehen, wir wissen nicht, was passieren wird, wir wissen nicht, wie das morgen sein wird, kann es vorkommen, dass wir ständig in Angst verharren.
Auf der anderen Seite hat die europäische Kultur viele „furchtlose“ (in diesem Sinne wären es eher „angstlose“) Helden produziert, deren einziges Verdienst darin bestand, keine Angst vor der Zukunft zu haben.
Es ist nicht nur der Begriff der Zeit, der uns ein morgen haben lässt. Es ist die tägliche Lebenserfahrung, die Europäer in Angst versetzt.

2. Und die Angst vor dem Tod
Der Tod existiert nicht. Wir haben ihn aus der Kultur verbannt. Es gibt den Tod manchmal in den Nachrichten (dann sind wir alle schrecklich entsetzt). Im täglichen Leben spielt er keine Rolle mehr. Wir haben den Tod in den Käfig gesteckt, ähnlich, wie Kant einst Gott in einen Käfig gestellt hat. Und wir hoffen nun, dass wir so dem Tod entkommen können. Oder wollen die Europäer auch der Angst vor dem Tod entkommen? Auch darüber schrieb Heidegger.
Das Dilemma ist, dass wir weder ontologisch noch medizinisch eindeutig beschreiben können, wann der Tod eintritt. Medizinisch gesehen vielleicht sogar nie, so dass wir eventuell ewig leben könnten (an Apparate angeschlossen, die unsere Körper mit allem lebenswichtigen versorgen).
Dank dem Tod (und der ungelösten Problematik seines Eintritts) haben wir die Möglichkeit gefunden, unendliche Angst zu spüren.

3. Und die Politik
Oder soll ich lieber sagen, Religion? Die europäische zumindest ist auf Angst gebaut. Sie diente ja lange Zeit als Legitimierung. Derjenige, der vorgab, Kontakt mit höheren Stellen zu haben (und in der europäischen Erzählung war es der Gott oder die Götter), der bestimmt auch das Bild des Jenseits. Der kann also auch bestimmen, ob wir denn Angst vor etwas haben, das wir nie erleben werden (der eigener Tod kann nicht erlebt werden, da hat Heidegger schon recht, auch wenn der Tod das Ende des Lebens markiert, kann dieser nicht erlebt werden).
4. Und die Politik
Doch darüber haben wir bereits an vielen Stellen geschrieben. Und wir möchten uns hier nicht wiederholen. Also sei lediglich so viel gesagt, dass Angst als eine der stärksten Emotionen genutzt wird.

5. Und das Leben
In Angst. Denn das ist, was den Europäern (ich würde allerdings auch Nordamerika dazu zählen), am Ende bleibt. Angst als ein ständiger Begleiter. Angst, die sowohl religiös als auch politisch gewollt und ontologisch (obgleich ich die europäischen Ontologien, gelinde gesagt, wirr finde) erklärt ist. Ein Normalzustand also. Aus dem Religionen, Politiken und Metaphysiken entstanden sind.
Botschaften in der Fremde
Botschaften in der Fremde

Der Begriff der Fremde impliziert zwei, besser gesagt drei Perspektiven (von der Perspektive als Begriff werden wir noch ein wenig später sprechen, jetzt nutze ich „Perspektive“ schlicht als Substantiv). Die erste, die mir einfällt hat etwas mit der Grenze zu tun (und auch mit der derridschen differánce, mit der Verschiebung der Grenze). Als erstes fällt mir da die Erkenntnisgrenze, von der wir manchmal in der Phänomenologie hören. Es ist eine bekannte Geschichte. Ein westlicher Intellektueller hat mal Japan besucht (es muss so… kurz nach der Meiji Restauration gewesen sein) und sah etwas, das er mit „Hocker“ benannte. Dabei rekurrierte er auf sein europäisches Wissen, das Wissen der Fremde (von der japanischen Perspektive aus), das aber in der Fremde (von der europäischen Perspektive aus) nicht funktionierte. Was der Europäer als „Hocker“ erkannte war in Wirklichkeit ein Tisch.
Und der Fremde?
Der weitere Begriff ist eben der Begriff des Fremden. Viveiros de Castro beschreibt, weshalb der Begriff gerade in der europäischen Ontologie eine so wichtige Rolle spielt. In dieser Ontologie (ich nehme Viveiros de Castro nicht so wörtlich an dieser Stelle) nämlich ist jede fremde Seele fremd. Wenn wir Tieren einen Gedanken zutrauen, gar Kultur, dann sind wir uns darin einig, dass Tiere keine Seele haben. Zumindest nicht dieselbe, wie wir Europäer. Sogar die Tatsache, dass „Wilde“ Seelen haben, mussten wir Europäer ausdiskutieren und von der Kirche absegnen, bevor wir sie akzeptierten. Schließlich gelangten wir zu einem Relativismus, in dem jede der Seelen (ich erweitere es um den Begriff der Entitäten, ja, vielleicht auch um den Begriff der Dinge) eine eigene Perspektive hat, von der er die Welt betrachtet. Wir mögen offen für die Perspektiven des Fremden sein, dennoch bleibt er „der Fremde“ (ohne jetzt auch Camus hier groß involvieren zu wollen).
Aber der Emigrant?

So verfahren wir auch mit den Fremden, die zu uns, in die Fremde kommen. Wir bemühen uns nach allen Kräften, diese zu integrieren. Ihnen das vermitteln zu wollen, was wir als „Common Sense“ betrachten. Ihnen unsere Ontologie mit aller Kraft aufzuoktroyiren. Dabei handeln die Europäer meistens unreflektiert (auch „Reflexion“ kommt später als Begriff und nicht wie jetzt als Substantiv vor), uninteressiert. Es ist wichtig, dass der Fremde, der Migrant, in dieser Gesellschaft funktioniert. Dass er sich schnell integriert, unsere Werte (oder was wir dafür halten) teilt. Und sich wie die Europäer (ok, ich nenne mich jetzt auch so) benimmt. Am besten, wenn der Fremde in der fremden Gesellschaft nicht auffällt.
Aber die Perspektive?
Dabei lassen wir völlig außer Acht, dass ebenfalls der Emigrant mit einer Ontologie zu uns kommt. Was wissen wir denn so groß von den migrantischen Ontologien? Höchstens das, was wir irgendwo gelesen haben. Höchstens vielleicht ein Buch darüber, wie es denn so in der Fremde ist. Natürlich. Einige sensiblen werden versuchen, sich in die Perspektive des Fremden einzufühlen. Oder sich einreden, dass sie das täten, was sie dann stolz unter Bekannten erzählen werden. Mit all ihren Rentensorgen und Immobilieninvestments. Dabei geht es nicht darum. Es kann sein, dass der Versuch schlicht daran scheitert, dass der Fremde eine völlig andere Ontologie besitzt. Von der wir nichts wissen, weil wir ihm ja eine andere Perspektive (als Substantiv) zuschreiben, die wir aus unserer eigenen ontologischen Tradition kennen.

Aber die Reflexion?
Die Frage wäre natürlich, was dem Fremden in der Fremde bleibt. Hierzu gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste ist, sich unterzuordnen. Die eigene Ontologie aufzugeben. Und den Diskurs der Fremde aufzunehmen. Die Frage wäre natürlich ob es in die andere Richtung auch so funktionieren würde (ich lasse jetzt die Argumente des Columbianischen Austausches ausser Acht, wenn es sie gab, dann unbewusst). Die zweite wäre, an seiner eigenen Ontologie zu halten. Wir (die Fremden) könnten aber dann immer noch Tische für Hocker halten. Ich bin mir nicht sicher, ob es so interessant wäre.
Es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Einen dritten Weg. Der vielleicht subversiver ist, dennoch viel produktiver (da ich in der europäischen Ontologie nicht gefangen bin, kann ich jetzt als Nichteuropäer sprechen). Dieser Weg besagt, dass jede Reaktion, jeder Reflex, den Beobachtenden beschreibt. Wie also der Europäer auf den Fremden reagiert, beschreibt auch den Europäer selbst. Daher würde ich den Aufruf Latours etwas paraphrasieren. Seien wir, die Fremden, die Anthropologen, die für unsere Ontologien Europa kartographieren, sie erkunden und entdecken. Und verhalten wir uns dabei, wie jeder Anthropologe (Levy – Strauss hat es so schön beschrieben) – stören wir sie nicht, lassen wir sie machen, lächeln wir einfach und winken dabei freundlich.










